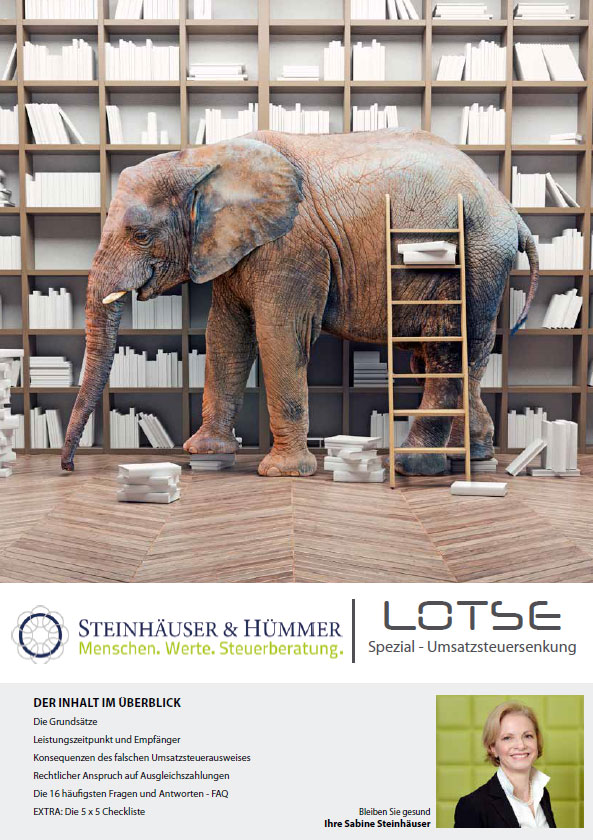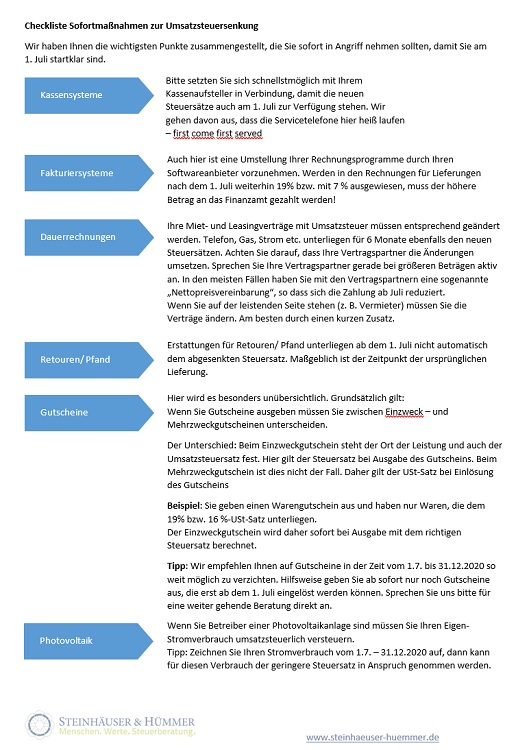So kommen Sie schneller an Ihr Geld-7 Tipps für Ihr Forderungsmanagement
Das Zahlungsverhalten der Kunden – ein Thema das wohl jedes Unternehmen beschäftigt.
Eines ist klar: je früher die Kunden zahlen, desto besser für Ihre Liquidität.
Und natürlich haben Sie einen echten finanziellen Vorteil, denn jeder Tag Zahlungsfrist kostet Sie bares Geld.
Machen Sie doch einmal die Probe aufs Exempel und rechnen Sie aus, wie viel Zinsen Sie pro Tag sparen können. Auf dem Portal www.forderungsmanagement.com finden Sie dazu einen einfachen Rechner.
http://www.forderungsmanagement.com/einsparpotenzial
Doch wie bewegen Sie die Kunden dazu, pünktlich zu zahlen? Hier 7 einfache und bewährte Tipps aus der Praxis in der Reihenfolge ihrer Anwendung:
1. Stellen Sie Rechnungen zeitnah
Die einfachste, aber häufig missachtete Regel: Stellen Sie Ihre Rechnung am Tag der Leistungserbringung, zumindest innerhalb von 3 bis 5 Arbeitstagen. Die Zahlungsbereitschaft ist hier am höchsten, da der Kunde Ihr Werk unmittelbar vor Augen hat und den Wert der Leistung zu schätzen weiß.
2. Geben Sie einen konkreten Zahlungstermin an
Der Hinweis „Überweisung innerhalb zwei Wochen“ kann vom Kunden zu seinen Gunsten ausgelegt werden. Besser „Vielen Dank für Ihre Überweisung bis zum 27.4.“
3. Prüfen Sie die Bonität
Um sich von vornherein vor bösen Überraschungen zu schützen, prüfen Sie die Bonität Ihres Kunden vor dem Abschluss von Lieferverträgen. Räumen Sie keinen Kredit ein, wenn der Kunde zahlungsschwach oder zahlungsunfähig ist.
Tipp: Bonitätsauskünfte erhalten Sie von den Wirtschaftsauskunfteien, zum Beispiel von Creditreform oder von Schufa.
4. Räumen Sie Zahlungsziele früh ein
Bieten Sie Ihrem Kunden Anreize, möglichst schnell zu zahlen. Sollte Ihr Kunde nicht in der Lage sein, sofort komplett zu bezahlen, sprechen Sie rechtzeitig mit ihm darüber. Größere Beträge sollten Sie absichern, zum Beispiel über Bankbürgschaften.
Rechnen Sie außerdem die Kosten, die Ihnen durch den Lieferantenkredit entstehen, in den Angebotspreis mit ein.
5. Fordern Sie Abschläge
Sie können Abschlagszahlungen von Ihrem Kunden fordern, wenn Sie Werksleistungen erbringen. Die Höhe der Abschläge richtet sich nach dem Wertzuwachs, den der Kunde durch Ihre Leistung erlangt hat. Auch die Kunden schätzen das oft, da sie dadurch die eigene Liquidität besser steuern können.
6. Überwachen Sie die Zahlungseingänge
Überwachen Sie Zahlungsbeträge und -termine genau. Verlangen Sie von Ihrem Kunden, dass er pünktlich zahlt. Und liefern Sie selbst auch pünktlich.
Tipp: nutzen Sie moderene Fakturierungssysteme, die Ihnen tagaktuell diese Informationen liefern.
7. Organisieren Sie Ihr Mahnwesen
Bei gewerblichen Kunden gilt: Schuldner geraten 30 Tage nach Eingang der Rechnung in Verzug – auch ohne Mahnung. Wenn die Fälligkeit nach dem Kalender bestimmt ist, befinden sich die Kunden am Folgetag bereits im Verzug (auch, wenn das vereinbarte Zahlungsziel kürzer als 30 Tage ist). Gegenüber Privatkunden muss auf der Rechnung ausdrücklich darauf hingewiesen werden.
Trotzdem sollten Sie Ihren Kunden an das Begleichen der Rechnung erinnern. Prüfen Sie aber vor der ersten Mahnung, ob Sie Ihre Leistung wie vereinbart erbracht haben.
Vermeiden Sie den Begriff „1. Mahnung“, denn das verleitet den Kunden dazu, auf die 2. Mahnung zu warten. Sie geben ihm also indirekt Zahlungsaufschub.
Gern beraten wir Sie bei den individuellen Fragen Ihres Forderungsmanagements. Sprechen Sie uns an.